Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
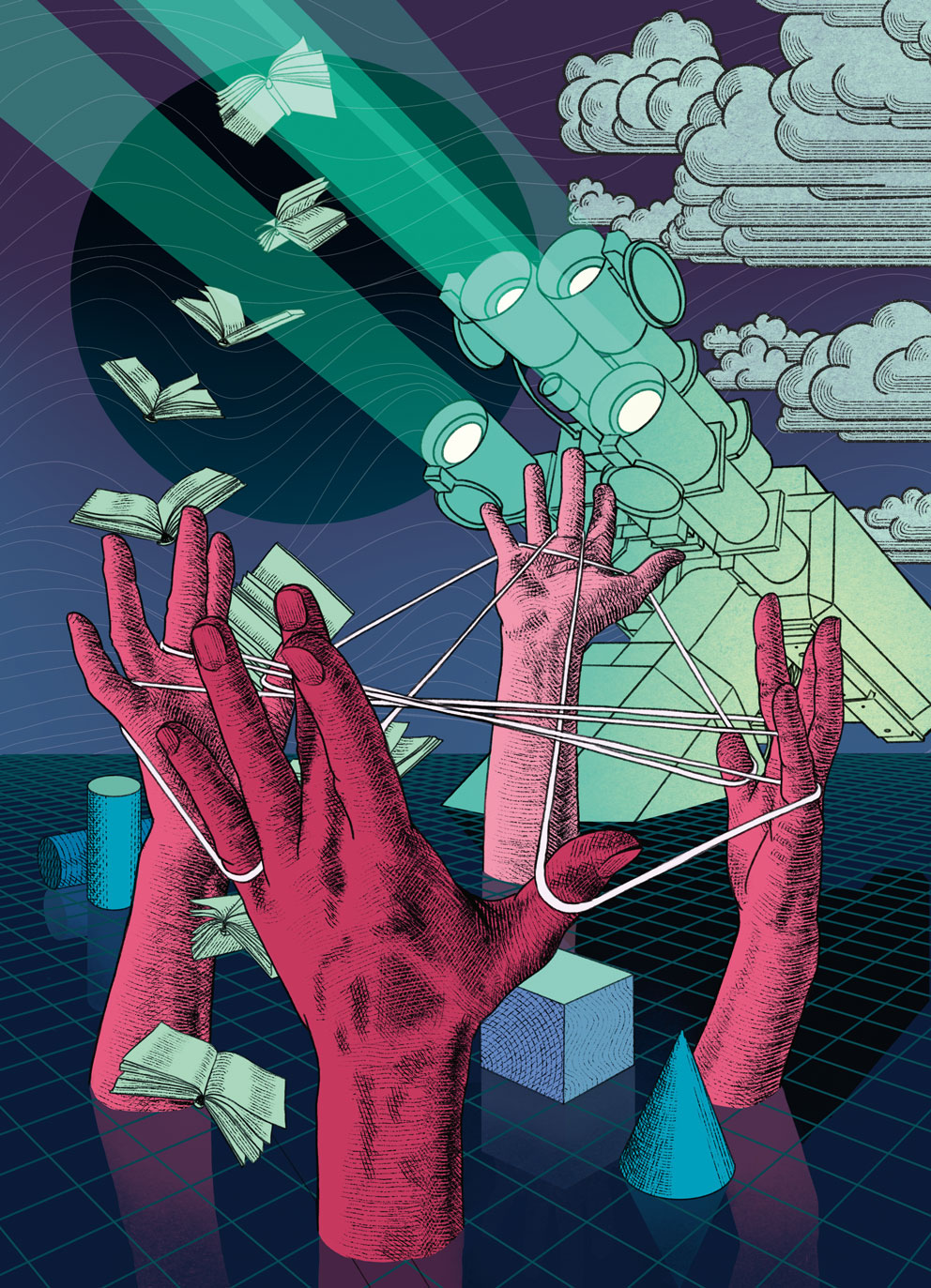
Als Alexander von Humboldt im Juni 1802 vom Chimborazo aus auf die Anden blickt, beginnt er, die Welt mit anderen Augen zu sehen. „Die Erde erschien ihm als ein riesiger Organismus, in dem alles mit allem in Verbindung stand“, so beschreibt es die Humboldt-Biografin Andrea Wulf. Humboldts holistische Naturauffassung revolutionierte die Wissenschaft; heute ist längst bewiesen, dass von einzelnen Zellen über unterirdische Pilzgeflechte ganze Ökosysteme in Netzwerken miteinander verbunden sind, Austausch betreiben und kommunizieren.
Das Konzept des Netzwerks hat seitdem eine einzigartige Karriere gemacht. Ob von neuronalen Netzen, dem Internet oder sozialen Netzwerken die Rede ist: Zur universalen Metapher wird das Netzwerk, als in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts „mit dem Paradigmenwechsel von der Physik zur Biologie und von der Soziologie zur Informatik nicht nur die biologischen Systeme des Lebendigen, sondern vor allem auch die informationellen Steuerungs-, Kontroll- und Kommunikationsnetze in den Mittelpunkt der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit rückten“, analysiert der Kulturwissenschaftler Hartmut Böhme von der Berliner Humboldt-Universität.
Netzwerke können Grenzen überschreiten und vermeintlich geschlossene Einheiten aufbrechen. Sie schaffen, wie im Falle des weltweiten Wissenschaftsnetzwerks der Humboldt-Stiftung, Verbindungen über Disziplinen, Institutionen und Nationen hinweg.
„Machen neue Technologien klimaschädliche Flugreisen zu Konferenzen oder Forschungsaufenthalten nicht obsolet?“
Dabei sind Begegnungen mit Menschen aus anderen Lebenswelten als der eigenen besonders fruchtbar. Denn spätestens seit dem einflussreichen Essay „The Strength of Weak Ties“ des amerikanischen Soziologen und Netzwerktheoretikers Mark Granovetters in den 1970er-Jahren weiß man, dass sich in Netzwerken gerade jene Kontakte als besonders produktiv erweisen, die zwischen Menschen zustande kommen, die zuvor nichts oder nur wenig miteinander zu tun hatten. Während man in seinem innersten Zirkel aufgrund der Nähe oft dieselben Informationen teilt und gleichförmiges Denken produziert, entstehen neue Impulse durch fremde Einflüsse.
Schwache Bindungen, Starke Ideen
Beispiele für die Stärke dieser „schwachen Bindungen“ lassen sich auch im Humboldt-Netzwerk zuhauf finden. So kam Holger Schönherr, Professor am Lehrstuhl für Physikalische Chemie I an der Universität Siegen, 2013 auf einer Konferenz in Südkorea mit der Nachwuchsforscherin Nowsheen Goonoo von der Insel Mauritius ins Ge- spräch. Die beiden Forschenden stellten fest, dass sie mit ähnlichen Materialklassen und Verfahren arbeiteten. „Dabei fielen uns beiden die vielversprechenden Synergieeffekte einer Kombination von Polyestern mit Polymeren auf Basis einheimischer nachwachsender Rohstoffe für biomedizinische Anwendungen sofort in Auge“, so Schönherr. Aus der persönlichen Begegnung erwuchsen mehrere Forschungskooperationen mit Aufenthalten von Nowsheen Goonoo in Siegen. Während die Siegener Wissenschaftler für ihre Forschung an biologisch abbaubaren Nanomaterialen von Goonoos Materialwissen über die in Mauritius einheimischen Pflanzen Aloe Vera und braunen Seetang profitierten, konnte die Gastforscherin aus dem kleinen Inselstaat im Indischen Ozean Erfahrungen in der Arbeit mit dem Rasterkraftmikroskop sammeln.

Als „Gewinn für beide Seiten“ beschreibt auch die Grünlandforscherin Nicole Wrage-Mönnig von der Universität Rostock ihre Zusammenarbeit mit dem Georg Forster-Stipendiaten Chabi Djagoun aus Benin. Der Kontakt war ebenfalls durch das Humboldt-Netzwerk zustande gekommen. Während der Ökologe aus dem afrikanischen Land die Rostocker Arbeitsgruppe dazu brachte, scheinbar selbstverständliche Annahmen zum Beispiel zur Photosynthese zu hinterfragen, konnte er am Lehrstuhl für Grünland und Futterbauwissenschaften das Isotopenverhältnis- Massenspektrometer nutzen, um zu erforschen, von welchen Pflanzenarten sich die vom Aussterben bedrohte Leierantilope in seiner Heimat ernährt.
„Der öffentliche Charakter digitaler Netzwerke ist ein Schlüssel zu mehr Diversität.“
Was viele Mitglieder der Humboldt-Familie persönlich erleben, bestätigen nicht nur die Evaluationen der Stiftung, sondern auch Arbeiten wie die von Caroline S. Wagner, Professorin für Internationale Beziehungen an der Ohio State University, USA. Sie erforscht die Beziehungen zwischen dem Wissenschaftssystem eines Landes auf der einen und Politik und Gesellschaft auf der andere Seite. Wagner hat gemeinsam mit Koen Jonkers von der britischen University of Cambridge die Publikations- und Zitationsdaten von 36 Nationen untersucht. Das Ergebnis: Die Stärke der Wissenschaft in einem Land, gemessen an der Zahl der Publikationen, der Zitationshäufigkeit und der Co- Autorenschaften, korreliert mit der Offenheit des Landes, internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufzunehmen. „Wenn Menschen reisen können, entstehen Ideen und Kreativität. Je offener Staaten für den internationalen Austausch sind, desto größer sind auch ihre wissenschaftliche Bedeutung und ihr Einfluss“, lautet Caroline S. Wagners Resümee. Die Mobilität von Wissenschaftlern trägt also dazu bei, dass sich Netzwerke und Staaten den Herausforderungen der Zukunft stellen können. Doch inwiefern müssen Forschende in einer digitalisierten Welt überhaupt physisch am gleichen Ort sein, um miteinander arbeiten und voneinander profitieren zu können? Machen neue Technologien klimaschädliche Flugreisen zu Konferenzen oder Forschungsaufenthalten nicht obsolet?
Digital ist offener
„Physische und virtuelle Mobilität dürfen sich nicht in einer binären Opposition gegenüberstehen. Es gilt herauszufinden, wie beide in dem hochflexiblen und dynamischen Geflecht von verzahnten Netzwerken am besten zur Anwendung kommen, damit das nötige Zukunftswissen produziert wird. In neuen, mehrdimensionalen Netzwerken ist dieses Wissen als Struktur, nicht nur als individuelles Gut zu begreifen. Es ist an uns allen, es zu gestalten, das ‚Humboldt-Netzwerk 4.0‘ “, appelliert Hans-Christian Pape, Präsident der Humboldt-Stiftung.
Die amerikanische Mikrobiologin Beronda Montgomery hat sich damit auseinandergesetzt, wie die sozialen Medien und digitalen Plattformen genutzt werden können, um nachhaltige und funktionierende Netzwerke zu schaffen. Auch sie selbst ist in digitalen Netzwerken unterwegs: „In den letzten Jahren war ich selbst sehr aktiv auf Twitter. Einige meiner Gruppen dienen vor allem dem fachlichen Austausch über meine Forschungsthemen. Andere dienen dem Empowerment, etwa die Gruppe #BLACKandSTEM, eine Community zur Unterstützung von afroamerikanischen Menschen in den Naturwissenschaften“, berichtet Montgomery. Sie sieht den Vorteil der digitalen Netzwerke in ihrer Offenheit. „Der öffentliche Charakter ist meiner Meinung nach ein Schlüssel zu mehr Diversität. So können Individuen, die das Netz nach Ressourcen scannen, in Kontakt mit einer Gruppe treten, auf die sie sonst gar nicht gestoßen wären. Außerdem können Individuen, die nicht zur Fokusgruppe der Community gehören, mitlesen und mithören. Sie können bei relevanten Themen Stellung beziehen und als Advokaten für Minderheiten eintreten“, so Montgomery.
„Physische und virtuelle Mobilität dürfen sich nicht in einer binären Opposition gegenüberstehen. Es gilt herauszufinden, wie beide in dem hochflexiblen und dynamischen Geflecht von verzahnten Netzwerken am besten zur Anwendung kommen, damit das nötige Zukunftswissen produziert wird. In neuen mehrdimensionalen Netzwerken ist dieses Wissen als Struktur, nicht nur als individuelles Gut zu begreifen. Es ist an uns allen, es zu gestalten, das ‚Humboldt- Netzwerk 4.0‘“
Historisch betrachtet gehen neuartige Netze meist mit technologischen Entwicklungen einher. Das gilt auch für den Wissenschaftsbetrieb und erst recht für seine digitalen Netze. So zählen die digitalen Wissenschaftsplattformen ResearchGate und Academia.edu über 15 beziehungsweise 108 Millionen registrierte Nutzerinnen und Nutzer. Rund 10 000 Forschende, die bei der Registrierung lediglich eine Institutionszugehörigkeit angeben mussten, loggen sich laut ResearchGate täglich ein, um miteinander in Kontakt zu treten und Zugang zu den Papers zu bekommen, die dort schnell zur Verfügung gestellt werden, da lange Editions- und Redaktionsprozesse in Verlagshäusern entfallen. So erhält eine breite Masse einen leichten Zugriff auf Fachwissen, das sie weiterverarbeiten kann. Es entsteht damit ein neuer Rahmen, in dem Wissen getauscht und produziert wird. Diese virtuelle Mobilität von Wissen verändert die Form des Wissens selbst.
Schneller Wissenstransfer
Auch andere Methoden wie das Crowdreviewing, mit dem sich auch die Humboldt-Stiftung beschäftigt, nutzen die Möglichkeiten der Digitalisierung – in diesem Fall, um online das Gutachtenverfahren zu entlasten und zu flexibilisieren. Auch für das Klima wäre es gut, nicht nur Wissensinhalte, sondern auch die Forschenden vermehrt virtuell miteinander zu verbinden. „Ich selbst habe im vergangenen Jahr an einigen Konferenzen nur über Twitter teilgenommen, um meinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

Digitale Plattformen erweitern die Möglichkeiten, sich in wissenschaftlichen Communities zu engagieren und verringern zugleich Hürden in Bezug auf ökonomische und ökologische Bedenken“, findet Beronda Montgomery. Sie fühle sich mittlerweile auch wohl damit, Seminare über das Internet zu geben. Was jedoch auf der Strecke bleibe, seien die informellen Gespräche beim Kaffee oder beim Abendessen, betont die Amerikanerin. Dabei seien gerade diese meist so fruchtbar, bestätigt auch Caroline S. Wagner. Neunzig Prozent ihrer Wissenschaftskooperationen seien durch Face-to-Face-Kontakt entstanden, sagt Wagner.
Über 1 700 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in Deutschland im letzten Jahr eine Petition unterzeichnet, mit der sie sich verpflichten, bei Dienstreisen unter 1 000 Kilometern auf das Flugzeug zu verzichten.
„Neunzig Prozent meiner Kooperationen sind durch Face-To-Face-Kontakt entstanden.“
Während Organisationen überlegen können, zum Beispiel nur noch einzelne Repräsentanten mit dem Flugzeug auf Konferenzen zu schicken, die dann später als Multiplikatoren dienen, stellt trotz Klimawandel kein Experte den Sinn und Zweck von Forschungsaufenthalten infrage. Ein Hintergrund hierfür sind die unterschiedlichen Zugänge zu explizitem und implizitem Wissen, ein Konzept, das auf den Philosophen Michael Polanyi zurückgeht. Während es sich bei explizitem Wissen um klar formulierbares und reproduzierbares Wissen handelt, hat implizites Wissen immer eine persönliche Qualität. Explizites Wissen lässt sich gut auf digitalem Wege vermitteln, etwa über eine Online-Präsentation bei einer Konferenz oder ein Web-Seminar an der Uni, oder zum Teil über digitale Plattformen. Für das Erlernen und Nachahmen von implizitem Wissen, etwa bewährten Forschungspraktiken, ist die persönliche Anwesenheit in einer anderen Forschungsumgebung notwendig. Nur durch vertrauensvollen Umgang mit erfahrenen Forschenden haben junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Möglichkeit, von deren Arbeitsweisen, Methoden und informellen Praktiken zu lernen und so auch unerwartete Verknüpfungen zu bilden.
„Netze kommen immer nur als Netze in Netzen vor“, ist die Beobachtung von Hartmut Böhme. Und so sind Forschende heute längst an vielen Netzwerken gleichzeitig beteiligt, sowohl an analogen wie auch an digitalen. Sie und ihr Wissen müssen frei kursieren können, digital und analog. Reisen, insbesondere mit dem Flugzeug, werden seltener werden, diese Prognose sei gewagt. Doch persönliche Begegnungen werden sich oft nicht ersetzen lassen.
aus Humboldt Kosmos 111/2020
